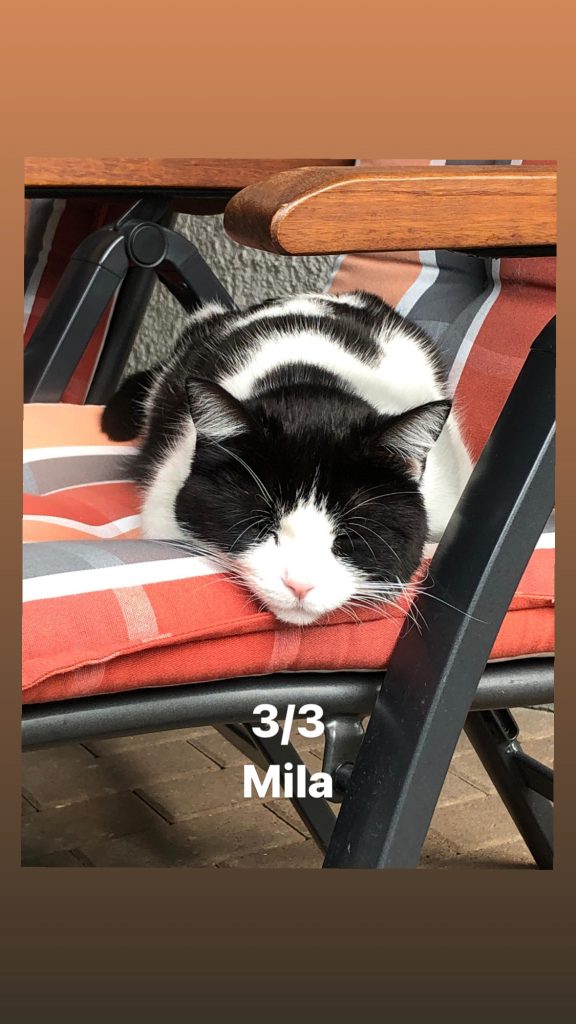Projekt: Geschichte
Vorwort:
Bei diesem Projekt handelt es sich um einen Auftrag von meiner ehemaligen Lehrperson Samuel „Sam“ Zahnd im SEMO/MOVE in Thun. Er gab uns die Möglichkeit eine Geschichte zu schreiben, bei der uns keine Schranken gesetzt wurden- bis auf die, dass es sich um eine Kurzgeschichte handeln sollte. Da dieser Begriff sehr dehnbar ist, kam ich in 8 Stunden auf 10 Seiten Geschichtsmaterial.
Bei meinem Ansatz zur Geschichte handelt es sich um einen Ausschnitt der wahren Welt-Geschichte „1900 – 2000 Jahrhundert“. Vieles in meiner Geschichte hat einen wahren Ansatz aus Auszügen aus dieser vergangenen Zeit. Folgendes soll einige Geschehnisse aus der Wirklichkeit widerspiegeln die ich in meiner Geschichte verwendet habe.
-WW I: 28. Juli 1914 – 11. November 1918 (4 Jahre, 3 Monate und 2 Wochen).
-Eintritt der Vereinigten Staaten 6. April 1917 in den Ersten Weltkrieg.
-Einberufung der Soldaten aus den Vereinigten Staaten November 1917
-Vier Millionen Soldaten aus den Vereinigten Staaten wurden nach Europa geschickt.
-In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 1917 setzen die Kaiserlichen Truppen des Deutschen Heeres das Senfgas frei.
Notizen
John:
Geb. 1895 – gest. 1939 / Born. 1895 – died. 1939:
WW I:
28. Juli 1914 – 11. November 1918 (4 Jahre, 3 Monate und 2 Wochen)
Eintritt der Vereinigten Staaten 6. April 1917 in den Ersten Weltkrieg
Einberufung: Einberufung. 1917. November
Projekt: Geschichte:
Als John etwa 12 Jahre alt war, begann er kleinere Jobs zu erledigen, um seine Mutter zu unterstützen. Etwas Taschengeld behielt er für sich zurück. In dem Monat, als er 17 Jahre alt wurde, wurde Henry Moore, sein Arbeitgeber, eingezogen und John musste den Laden alleine schmeissen. Seine Mutter versuchte ihm so gut es ging dabei zu helfen. Als jedoch auch John eingezogen wurde war seine Mutter schon sehr krank und gebrechlich. Darum fragte er einen benachbarten Barkeeper, ob nicht er Lust hätte, den Laden weiterzuführen. Bei ihm konnte John sicher sein, dass er nicht eingezogen wird, denn bei einer Barschlägerei war ihm ein Messer in die Hand gerammt worden. Nach diesem Unfall fiel ihm auf, dass seine rechte Hand gespalten war. Der Barkeeper willigte ein und nun war es für John an der Zeit, Lebwohl zu sagen. Zumindest für eine Zeit lang. Als John aus dem Krieg zurückkehrte, war allen klar, dass er Schreckliches durchlebt haben musste. Aus der Zeitung hatten die Bewohner erfahren, was seinem Batallion passiert war. Sein Freund, der Barkeeper, der übrigens mit richtigem Namen Adrian Leemore hiess, wurde in den Kreisen der Barkeeper auch die «Kralle» genannt. In diesen Kreisen war er dafür bekannt, einer der letzten «Gentleman-Keeper» zu sein. Adrian erzählte John, dass er bisher nichts von Henry Moore, dem ursprünglichem Besitzer der Kneipe gehört habe. Adrian berichtete John, dass er immer die Post, wenn mal welche reinkam, für Henry aufbewahrt. In der Zeit, in der John weg war, machte Adrian gutes Geld mit der Kneipe. Sie boomte regelrecht nach dem Krieg. Viele der vier Millionen Soldaten, die nach Europa geschickt wurden, kamen mit dem Schiff aus Frankreich zurück. Auch viele der Flüchtlinge kamen mit dem Schiff und suchten hier in New York ein besseres Leben und bessere Arbeit. Doch nach diesem langen Gespräch wollte Adrian wissen, wie es im Krieg so war und was er alles mitmachen musste. Nun John schluckte so laut, dass die ganze Kneipe verstummte. «Es war die Hölle! Tag und Nacht mussten wir höllisch aufpassen, dass wir von keinen Kameraden oder durch den Beschuss von Mörsern und Artilleriefeuer der Deutschen sterben. Dann am 12 auf den 13. Juli 1917 liessen die Deutschen das Beast los, Senfgas!» Nach diesem Wort wurde es noch stiller als zuvor, man hätte eine Mücke hören können. Keiner der Anwesenden in der Kneipe wagte es, auch nur zu schlucken oder zu atmen. Alle, die ab und zu in die Zeitung schauten, wussten, was Senfgas bedeutete. John erzählte weiter vom gleichzeitig besten und schrecklichsten Tag seines Lebens.
Sie waren in der Nacht vom Senfgasangriff überrascht worden. Keiner von ihnen wusste, wie lange sie dem Senfgas ausgesetzt waren. John und 4 weitere Kameraden lagen zusammen in einem Krater einer Artillerie-Granate, Jeder von ihnen sollte jeweils 4 Stunden die Nacht über Wache halten, als John plötzlich einen stechenden Schmerz auf seinem Arm verspürte und vor Schmerz aufschreckte. Als seine Augen sich langsam an die Dunkelheit gewöhnt hatten, wagte er es, auf seinen schmerzenden Arm zu sehen. Jede Bewegung, jede Berührung und jeder Gedanken an diesen Unterarm trieb ihm Tränen in die Augen. Erst als die grössten Schmerzen nachliessen, konnte er einen klaren Gedanken fassen. «Ich muss die anderen wecken!», dachte er. Keiner der anderen vier Kameraden war wach. Eigentlich hatte Berry, der Kanonier, die zweite Nachtwache. John machte sich daran, alle aufzuwecken und in Sicherheit zu bringen. John und seine vier Kameraden machten sich schleppend auf den Rückweg zum Hauptschützengraben. Weg von der Frontlinie. Als sie bei einem der Schützengräben ankamen, rief eine kratzende Stimme: «Wer ist da?»
Sie riefen mit letzter Kraft zurück «Oi! It’s us, it’s us, can’t you see?»
«Okay Okay Okay. Kommt her!», rief die kratzende Stimme.
Im Morgenschein der Sonne erhob sich eine Hand und winkte sie zu sich: «Kommt schon! Schnell, bevor sie uns sehen!»
In diesem Moment stürzte Berry, der als letzter in den Graben springen sollte, auf die Knie. Ein nicht unerhebliches Loch klaffte in seiner Brust. Er sackte noch weiter in die Knie. Er schaute an sich herunter, hob seine linke Hand und steckte einen seiner Finger in die Wunde. Im gleichen Moment drehten sich die anderen um, da sie den Nachhall der abgefeuerten Kugel hörten. Nachdem John sich umgedreht hatte und den zusammengesackten Berry sah, der sich grade den Finger in die klaffende Wunde steckte, war ihm sofort klar, dass jemand sie beim Verlassen des Kraters gesehen oder gehört haben musste. Nachdem Berry wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, röchelte er den anderen zu: «Helft mir bitte!»
Ganz plötzlich durchfuhr eine weitere Kugel seine Schädeldecke und zerriss damit seinen Schädel. Wieder hörten sie den Nachhall der Kugel. Berry stürzte nun von seinen Knien komplett auf den Boden. Der Schlag, der ihn zum zweiten Mal durchfuhr, hatte in nun komplett niedergestreckt. Mit einem leisen Platschen schlug er auf dem Boden auf. Der Mann, der sie zu sich gewunken hatte, sagte: «Lasst ihn liegen, wir können nichts mehr für ihn tun.»
Einer der vier anderen fing an zu schluchzen.
«Reiss dich zusammen», sagte der Mann mit der krächzenden Stimme. «Ist das deine erste Leiche, Kanonier?»
Der junge Mann nickte wortlos.
«Nun müssen wir euch von hier wegbringen, kommt schon!»
Die Vier rannten wortlos und voller Schmerz hinter dem Mann her. Nach etwa 3 Kilometern kamen sie an den Artillerie-Batterien vorbei. Der Mann rief zu ihnen nach hinten, dass es noch 500 Meter seien, die sie noch vor sich hatten, bevor sie behandelt werden konnten. Sie sahen schon von Weitem die weissen Zelte. Als sie am Ende des Ganges ankamen, öffnete sich dieser. Der Matsch war mit Blut durchtränkt, von überall hörte man Schreie und Schluchzen. Aus einer der Zellen trat eine Krankenschwester, die einen Topf mit Blut und anderen Resten in den Matsch leerte. Als sie John erblickte, steckte sie ihren Kopf zurück ins Zelt. John konnte nur einige wenige Worte verstehen. Die Dame sprach offenbar Französisch. Das verwunderte ihn aber nicht, schliesslich waren sie hier in Frankreich. Als sie den Kopf wieder aus dem Zelt zog, kam sie auf John zu. Hinter ihr kamen vier Männer aus dem Zelt auf sie zu gerannt. Sie brachten eine Trage. Da John der erste von den Vieren war, der ankam, wurde er auf die Trage gelegt und in das Zelt befördert. Die Schwester sprach mit einem weiteren Mann. Sie schauten ihn dabei oft an und tuschelten etwas, das John nicht verstehen konnte. Der Mann verschwand danach plötzlich. Nun wendete sich die Schwester John zu. Nicht ganz akzentfrei aber ganz gefasst sagte sie zu ihm, dass sein Arm amputiert werden müsse, da die Verletzungen so gravierend waren.
«Es werden Narben auf ihrer Haut zurückbleiben. Ihren restlichen Körper können wir so verbleiben lassen» sagte sie.
John wurde etwas später mit Morphium ruhiggestellt. Als er wieder erwachte, spürte er zunächst nichts, Als er an sich herunter schaute, fehlte ihm sein Unterarm. Die restlichen Blasen wurden aufgestochen und verbunden. Er merkte dies daran, dass eine der Blasen, die an seinem Bein geklafft hatte, nun höllisch schmerzte. Unter dem Verband und auch durch den Verband drang immer noch ein übler Gestank. Dazu spürte er, dass aus der Wunde noch Blut oder Eiter austreten musste. Er merkte, dass unter seinem Verband eine Flüssigkeit umherschwappte.
Sein Blick wanderte durch das geschlossene Zelt. Er fand die Schwester bei einem der vier anderen vor, sie trug unter ihrem rechten Arm ein Klemmbrett. Mit der linken Hand griff sie an den Hals des jungen Mannes. Sie nahm die Anhänger, die er um den Hals trug in die Hand, sein Kruzifix und seine Hundemarken spiegelten die Reflektion in der Öllampe wider. Die Schwester brach eine der Hundemarken entzwei und holte das Klemmbrett hervor. Mit ihrem Kaugummi fixierte sie die Hundemarke auf einem Blatt Papier, und schrieb etwas dazu. Nach diesem nur kurz dauernden Prozesse legte sie die grau-braune Decke über seinen Kopf und wandte sich in einem Zug zu John um. Mit ihrem leichten Akzent fragte sie ihn: «Wie geht es ihnen? Wir müssen noch einmal den Verband wechseln, wäre das möglich?»
Stotternd erwiderte er ein kleinlautes «Ja.»
Sie rief eine weitere Schwester hinzu, die sein Bein etwas anhob, damit sein Verband entfernt werden konnte. Nach der Entfernung des Verbandes wurde ein neuer Verband angebracht. Die Schwestern im Lazarett besprachen sich, dabei begutachteten sie das Bein mit kritischen Blicken. Diese Begutachtung dauerte etwa zwei Minuten. John fragte immer wieder was los sei, bekam aber keine Antwort. Nach diesen zwei Minuten verschwand die dazu geholte Schwester mit den Resten des alten Verbandes. Als er und die Schwester wieder ganz alleine waren, fragte John sie erneut, was es zu besprechen gab. Sie antwortete, dass viele der Blasen aufgestochen und komplett entfernt werden mussten. John unterbrach sie nach diesen Infos und fragte: «Werde ich je wieder laufen können?» Die Schwester antwortete mit einem leichten Schmunzeln: «Sie werden wohl nicht mehr einen Model Job in Paris kriegen…»
Beide fingen leise an zu lachen, und von nun an schaute die Schwester öfters als nötig bei ihm vorbei. So ging das etwa vier Wochen weiter. In Woche drei konnte John schon wieder ohne Schmerzen gehen, doch ihm machten die Phantomschmerzen seines amputierten Armes noch Probleme. Sie versuchte, ihn von diesen Schmerzen so gut es ging abzulenken. Bei einem nächtlichen Rundgang, den sie während ihrer Schicht machte, entdeckte sie John, der schwitzend und zitternd wohl aus seiner Pritsche gefallen sein musste lief direkt zu dem Wassertrog, der hinter dem Zelt stand. Sie tunkte ein Stück eines Wickels in das dortige Wasser und spurtete zurück zu John, legte ihm den Wickel auf seine Stirn und ohrfeigte ihn, bis er wieder zu Sinnen kam. Nachdem er erwacht war, richtete er sich mit Hilfe der Schwester auf und lehnte sich gegen das Feldbett. Die Schwester fragte John immer wieder, ob es im gut gehe. Die ersten ungefähr sieben Male reagierte er nicht auf das was sie fragte. Nachdem er wieder zur Besinnung kam, flüsterte er: «Ich brauche frische Luft!»
Er legte seinen Arm auf die Schulter der Schwester, die John ihn stützend aus dem Zelt half. Die beiden liessen sich auf dem Erdboden, der etwa zwanzig Meter weiter entfernt wieder zu einer Wise wurde nieder. John fragte die Schwester direkt nach ihrem Namen, da er sich für die Rettung bedanken wollte, denn vor seinen Augen war immer das gleiche abgelaufen, wie ein sich endlos wiederholender Traum. Er träumte immer und immer wieder von dem jungen Private, der auf grausame Weise den Tod gefunden hatte. Immer wieder redete er sich ein, dass er ihn hätte retten können, wenn er nicht wie angewurzelt dagestanden hätte. Doch unterbewusst musste er die Frage schon gestellt haben, die die Schwester betraf, denn er wurde durch ihre Worte unsanft aus seinen Gedanken und Vorstellungen gerissen. Auf seine Frage antwortete sie nur mit ihrem Namen: «Emma. Mein Name ist Emma.»
John blickte sie an, sie bemerkte dies und fragte ihn nach seinem Namen. Er brauchte einen kurzen Moment, bis er erwiderte: «Mein Name? Mein Name ist John.»
Nach dieser Antwort verstummte er wieder. Ein paar Sekunden verstrichen. Emma fragte, wo er herkomme. John wachte wieder aus seinem Sekundenschlaf auf und antwortete: «Aus Amerika. New York City.»
Ihre Augen fingen an zu funkeln. «Ich wollte schon immer mal die USA sehen!»
John zeigte ihr Fotos von seinen Freunden und von New York, und sie begann, wie wild auf die Fotos zu zeigen und Fragen über seine Freunde zu stellen. Dazu fragte sie ihn über alles aus, was es in NYC zu sehen gibt. Sie redeten, bis die Sonne aufzugehen begann. Über die ganze Nacht hinweg hatte es kleinere Schiessereien in der Umgebung gegeben, Artillerie und Mörserfeuer. In der Ferne vernahm man leise Schreie. Dies alles ging in ihrem Gespräch unter, sie liessen sich durch nichts stören.
Diese nächtlichen Gespräche fanden jetzt jede Nacht statt. Nach etwa zwei Wochen kam Emma mit einem Brief zu ihm. Er öffnete diesen und verzog nach dem Lesen seine Miene. «John, was ist los?», fragte Emma.
«Ich werde zurück beordert wegen meinen Verletzungen.»
Emma brach in Tränen aus. «Emma beruhige dich, hier! Hier! Gib mir mal deinen Stift»
John schreib mit ihrem Stift seine Adresse auf den Brief Umschlag: Midtown, Manhattan. West 30th St. und Ninth. Meine Bar ist eine Kellerbar. Du wirst mich finden, glaub mir!»
Ohne dass sie es bemerkte, drehte er den Umschlag um und schrieb: «Wenn du kommst, habe ich sie wieder instandgesetzt.»
Die Zeit bis zur Abreise verging wie im Fluge. In seinem Brief wurde sein Marschbefehl erklärt. Er solle sich bei seinem Befehlshaber melden, und das tat er dann auch. Noch in derselben Nacht ging er zu seinem befehlshabenden Cornel, Brandon McFee.
John salutierte wie gewöhnlich. Der Cornel antwortete mit seiner alten, rauchigen Stimme auf das Salutieren von John nur mit einem lauten «Was wollen sie, Soldat?»
«Sir! Ich habe einen Marschbefehl für die Rückfahrt nach New York.»
McFee antwortete mit einem lauten «Geben sie den Wisch mal her, Junge!»
Er überflog den Brief nur und legte ihn nach dem Lesen auf seinen Tisch. Sein Gesicht verzog sich zu einer grimmigen Miene.
«Was für ein Mist! Wir sind doch schon zu wenige hier, mit was soll ich die Frontlinie zusammenhalten, etwa mit Kaugummis oder was? Ich bekomme keine neuen Soldaten, sagen sie! Ich kann doch jetzt schon nicht mehr alles abdecken!»
«Sir, bei allem Respekt, das ist nicht mein Problem», antwortete John.
«Jaja! Haben sie einen Stift?»
John gab ihm den verlangten Stift. Der Cornel setzte seine Unterschrift darunter und gab John den Wisch, wie er ihn genannt hatte, zurück.
«Los Junge, gehen sie!»
John salutierte das letzte Mal dem Cornel und machte in einem Satz kehrt und verliess das Zelt. John war vielleicht fünf, allerhöchstens zehn Minuten in dem Zelt mit dem Cornel gewesen. In dieser Zeit hatten sich verschiedenste Männer auf dem improvisierten Vorplatz eingefunden, die in drei Reihen standen, sassen und auf Liegen lagen. Neben dem Eingang standen leere Munitionskisten von Mörser- und Artilleriegeschossen. Über die letzten Tage hinweg hatten hunderte Soldaten in Tag- und Nachtschichten an einem der nach Norden führenden Schützengräben gearbeitet, um diesen zu einer zweispurigen Strasse zu verbreitern, damit Kutschen, Droschken, Fahrräder und die ersten Charabanc-Busse durchfahren konnten. Als John auf den Kisten stand, konnte er die langen Männerketten sehen, die bis zum Horizont reichten. Hinter dem die Sonne aufzugehen begann. Als John die Ketten lange genug beäugt hatte, drehte er sich, immer mit dem Blick auf die Strasse, nach Norden um. Etwa in ein bis zwei Kilometern Entfernung, schätzte er, erschien am Horizont die Wagenkolonne. Dies teilte er lautstark allen Umstehenden mit.
«Wie viele sind es?», rief einer aus der Menge. John erwiderte: «Bisher sehe ich etwa 30 Wagen und Kutschen!», und um weiteren Fragen vorzubeugen, sagte er: «Sie brauchen wohl noch geschätzte 40 Minuten.»
Alle, die noch nicht sassen, setzten sich jetzt hin. John sprang von den Kisten zurück und schnorrte sich eine Zigarette bei dem wachhabenden Offizier, setzte sich auf eine der Kisten und paffte an seiner Zigarette. Dabei bemerkte er nicht mal beim ersten Mal, dass er sich an der Zigarette verbrannt hatte. Als er fertig war mit Rauchen blickte er in die aufgehende Sonne. Nach etwa 30 Minuten ertönte ein Blasshorn. Dies sollte wohl signalisieren das die Kavallerie eingetroffen war. Alle der Sitzenden begannen, sich zu erheben. John fiel auf, dass die ersten Wagen leer vorfuhren. Viele der neuen Soldaten liefen neben den Wagen her und die nachfolgenden Wagen waren mit Männern vollgestopft. Einer der Fahrer sass ab, ging auf die drei Reihen Männer zu und begann seine Ansprache: «Also meine Herren, die ersten vier Wagen können nicht besetzt werden. Es wird noch fünf Minuten dauern, bis sie alle aufsitzen können. Alle, die nicht laufen können, Verletzte oder Tote: Auf die Karren mit ihnen, die Restplätze können dann alle anderen besetzen! Gibt es noch Fragen?»
Aus der Menge hörte man jemanden rufen: «Ja! Wieso müssen die ersten vier Wagen frei bleiben?»
«Wir brauchen denn Platz für die Planken für die matschige Strasse. Wir sollen die Strasse damit auslegen, damit wir nicht in diesem gottverdammten Schlamm stecken bleiben. Und für diese Planken brauchen wir die ersten vier Wagen. Nun meine Herren, machen sie sich bereit, es geht nach Hause! Eines noch: Wir brauchen ein paar Männer die uns helfen, die Wagen auszuladen.»
Nur in der Reihe der Unverletzten hoben sich ein paar Hände.
«Alle die die Hand hoch halten zu mir!», rief der Fahrer.
Es dauerte keine fünf Minuten bis alle Wagen von den Vorräten befreit waren, Ein ganzer Wagen war voll mit Whiskey-Kisten und anderen Spezialitäten.
«Die Kisten kommen in das Zelt vom Cornel, in das braune Zelt!»
Der Fahrer zeigte auf das Zelt, vor dem John stand. Als die Kisten endlich im Zelt verstaut waren, konnten die Soldaten aufsitzen.
«Meine Herren, aufsitzen! Zuerst die Verletzten, danach der Rest.»
John stellte sich zu der Gruppe der Verletzten.
«Alle Mann angetreten!», tönte es, und alle lösten sich aus der Gruppe und stellten sich in eine Reihe vor den Wagen auf. Der Fahrer bekam ein Klemmbrett gereicht.
«Also, so wird das ganze hier ablaufen: Zeigen sie Ihren Lappen vor, ich suche dann nach ihrem Namen werde diesen dann streichen. Wenn ich das okay gebe dürfen sie aufsitzen, wenn sich um Plätze gerangelt wird bleiben die beiden hier. Haben sie das verstanden?»
«Verstanden!» erwiderte die Menge erwiderte gut hörbar.
«Gut, der erste vortreten!»
Dieser trat vor und zeigte seinen Zettel, der Fahrer suchte nach seinem Namen und strich den Namen durch. «Gut mein Junge, gehen sie.»
John schaute links an der Menge vorbei. Er war der fünfte von vorne. Als John drankam, zeigte er seinen Zettel wie die anderen zuvor dem Fahrer. Dieser winkte ihn stumm durch. Die Männer, die nur auf Liegen transportiert werden konnten, wurden gleichzeitig ohne Kontrolle verladen. Das ganze Spiel dauerte etwa fünfundvierzig Minuten. Dann setzte sich der Konvoi langsam in Bewegung.
Die Fahrt nach Cherbourg würde zwei bis vier Stunden dauern. Als John gerade fragen wollte, ob sie es rechtzeitig zum Schiff schaffen würden, ergriff der Fahrer das Wort. Doch bei dem Lärm des Motors war er schwer zu verstehen. «Keine Sorge meine Herren, sie werden ihr Schiff erreichen, es wartet nur auf sie.»
«Wieso auf uns?», fragte John lautstark zurück.
«Naja, es ist die alte Cincinnati, die zum Truppentransporter umgebaut wurde. Sie trägt auch einen neuen Namen, USS Covington. Sie wird Sie unbeschadet nachhause bringen… – Oh, tut mir leid, ich habe nicht nachgedacht. Ich mache diesen Job noch nicht so lange, meine Herren.»
«Keine Sorge, alles gut, wir wissen, wie sie es gemeint haben», antwortete John.
Nach dreieinhalb Stunden kamen sie im Hafen von Cherbourg an, völlig durchgeschüttelt von der Fahrt über die teilweise holprige Strasse. Das Schiff lag in einem der Docks vor Anker. Vier lange Gateways liefen an der Seite nach oben bis auf das Vordeck, von dem man wohl in die verschiedenen Kojen verfrachtet wird. Nachdem alle abgesessen und alle Verwundeten an Bord gebracht worden waren, wurden die anderen von den Matrosen in vier Gruppen aufgeteilt, damit es keine Verzögerungen gab und damit keiner länger stehen musste als nötig. John war in Gruppe eins, er reihte sich als letzter in die Schlange ein. John drehte sich aus Gewohnheit noch einmal um. Zu seiner Verwunderung kam grade ein letzter Wagen an, der nur von Krankenschwestern besetzt war. In diesem fand er auch Emma wieder. Da er der letzte in der Reihe der Gruppe eins war, dachte sich John: «Ich habe wohl noch ein bisschen Zeit.»
In diesem Moment drehte er sich mit einem Satz um und ging auf den Wagen zu. Emma erkannte ihn sofort und sprang von dem Wagen ab und ging ebenfalls auf ihn zu. John fragte sie: «Was machst du denn hier?»
«Ich bin hier weil ein paar unserer Krankenschwestern uns wieder verlassen mit dem nächsten Schiff. Nach euch kommen die neuen Schwestern.»
John ergriff ihre Hand und zog sie beiseite. «Was ist?»
«Ich bin zwar der letzte, der an die Reihe kommt, aber ich habe nicht viel Zeit, also hör mir zu, nur kurz! Du weisst noch, wo du mich findest?»
«Ja, Midtown, Manhattan. West 30th St. und Ninth. Deine Bar ist in einem Kellergeschoss.» «Ja richtig.»
Er küsste sie auf die Wange und drückte sie nochmals fest.
«Junge, kommen Sie, wir müssen los!», rief einer der älteren Matrosen.
John löste sich aus der Umarmung und schritt die Gangway in grossen Schritten hinauf. Oben wand er sich nochmals um und schritt soweit zum Rand, wie es die Reling zuliess. Er blickte zu Emma zurück und bemerkte, dass sie an sich herunter zeigte. Sie holte immer wieder einen Zettel aus ihrer Brusttasche und zeigte dabei immer wieder mit ihrer anderen Hand abwechselnd auf John und ihre Brusttasche. Bis John endlich verstand, vergingen einige Sekunden. Nachdem er verstanden hatte, griff er mit seiner Hand in seine eigene Brusttasche und fand in dieser ein Stofftuch, auf dem sich ein rot leuchtender Kussmund befand. Ebenfalls mit diesem roten Lippenstift geschrieben stand eine kleine Nachricht an ihn darauf: «Liebster John, warte auf mich. Ich komme so schnell ich hier wegkann!»
John schnupperte an dem Tuch.
«Es riecht genau wie sie», dachte er sich und packte es zurück in seine Brusttasche. Auf der ganzen Fahrt nach Hause, die etwa sechs Tage dauerte, dachte John über einen neuen Namen nach für seine geliebte Bar, damit Emma ihn sofort finden würde. Seine ersten Ideen fand er alle schrecklich, bis er auf den passenden Namen kam, benötigte er fast die ganze Überfahrt: «The French Girl».